|
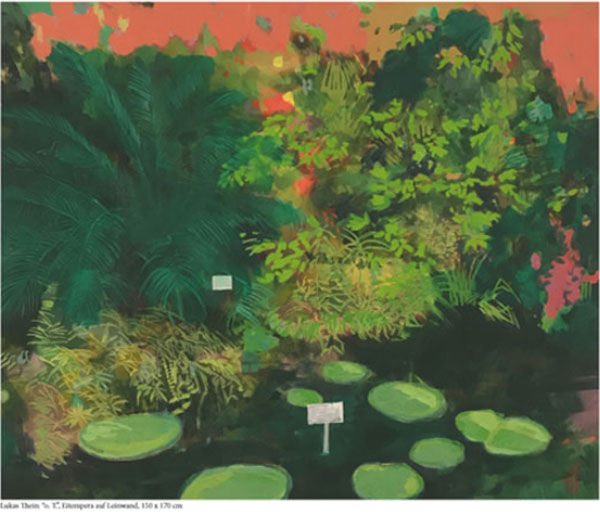
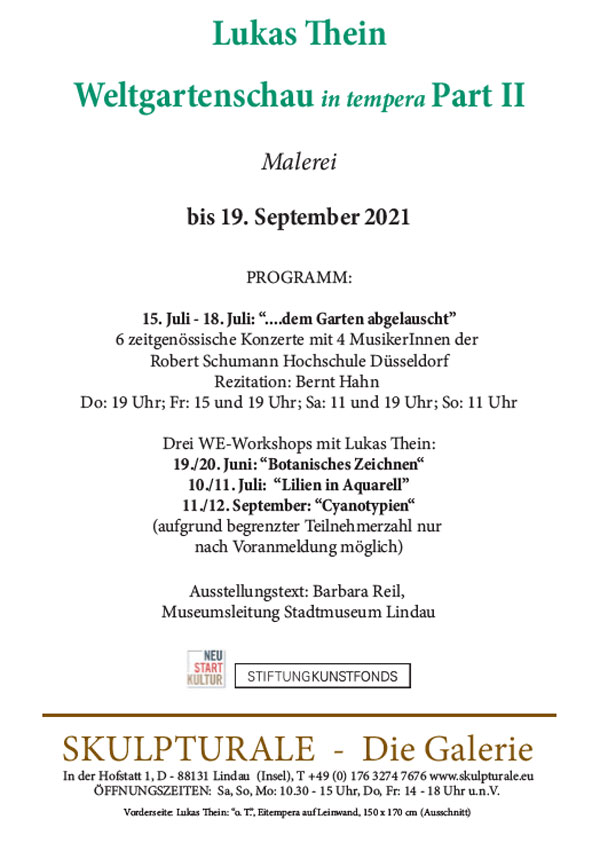
Barbara
Reil (Museumsleitung, Lindau):
Weltgartenschau – in Tempera
Part II (von
Lukas Thein)
Wir
betreten die Weltgartenschau von Lukas Thein, einem jungen Mann im roten Hemd
– womöglich dem Künstler selbst – folgend, durch einen Torbogen, der provozierend
violett vor einer schemenhaft-indifferenten landschaftlichen Szenerie
aufragt. So zeichenhaft die spitz zulaufende Form ins  Bild gestellt ist, so hartnäckig widersetzt sie sich allen
Deutungsversuchen und weigert sich letzten Endes mehr zu sein als – reine
Farbe. Als wildes Solo durchbricht er den gleichförmigen Rhythmus der durch
knappe Vertikalen angedeuteten Vegetation im Hintergrund und bringt das
Realitätsgefüge der Komposition gehörig ins Wanken. Bild gestellt ist, so hartnäckig widersetzt sie sich allen
Deutungsversuchen und weigert sich letzten Endes mehr zu sein als – reine
Farbe. Als wildes Solo durchbricht er den gleichförmigen Rhythmus der durch
knappe Vertikalen angedeuteten Vegetation im Hintergrund und bringt das
Realitätsgefüge der Komposition gehörig ins Wanken.
In
dieser Ausdrücklichkeit stößt uns der Maler nirgendwo sonst in der
Ausstellung auf den eigentlichen Beweggrund seiner künstlerischen Expeditionen,
die ihn – und uns in seinem Gefolge – häufig in tropische Gefilde, selten in
den berühmten deutschen Wald, immer wieder in Gewächshäuser und schließlich
zur Topfpflanze auf der Fensterbank führen.
Obgleich
seine Kunst letzten Endes erkennbar dem Gegenstand verhaftet bleibt, sind
Theins Ausflüge quer durch die verschiedenen Klima- und Vegetationszonen
seines höchstpersönlichen Weltgartens vor allem eins: Erkundungen im Reich
der Farbe, deren Wesen es zu ergründen und Wirkungsspektrum es auszuloten gilt.
 Bevorzugt bedient sich Thein der klassischen
Eitempera, und damit einer im besten Sinne „altmeisterlichen“ Technik, die
dem Künstler die Geduld und Beharrlichkeit eines Gärtners abverlangt. Der
oftmals langwierige Entstehungsprozess, der mit dem Anmischen der Farben
beginnt und neben dem schichtweisen Bildaufbau auch rabiate destruktive
Eingriffe in denselben beinhaltet – regelrecht ausradiert sind große Teile
des vom Sturm zerzausten Nadelwalds –, entspricht der Bewegung des Werdens
und Vergehens in der Natur, die sich der Betrachter*in im fertigen Gemälde
mitteilt. Bevorzugt bedient sich Thein der klassischen
Eitempera, und damit einer im besten Sinne „altmeisterlichen“ Technik, die
dem Künstler die Geduld und Beharrlichkeit eines Gärtners abverlangt. Der
oftmals langwierige Entstehungsprozess, der mit dem Anmischen der Farben
beginnt und neben dem schichtweisen Bildaufbau auch rabiate destruktive
Eingriffe in denselben beinhaltet – regelrecht ausradiert sind große Teile
des vom Sturm zerzausten Nadelwalds –, entspricht der Bewegung des Werdens
und Vergehens in der Natur, die sich der Betrachter*in im fertigen Gemälde
mitteilt.
Das
Ergebnis ist eine Malerei, die ihre Wirkung aus einer dynamischen
subjektiv-emotionalen Farbigkeit bezieht. Auch wenn sich das Kolorit wie das
Motiv nie ganz von der sinnlich erfahrbaren Wirklichkeit entfernt, bleibt es
ähnlich unberechenbar wie das Pflanzenwachstum allen menschlichen  Ordnungsversuchen zum Trotz regellos: Purpurrot
pulsiert – beunruhigend? – zwischen den Stämmen eines Palmenhains; hitziges
Orange und Pink lodern hinter dem Pflanzenwuchs am Rand des Seerosenteichs,
um im nächsten Werk zum Altrosa eines erschöpften Gewitterhimmels zu
verblassen. Ordnungsversuchen zum Trotz regellos: Purpurrot
pulsiert – beunruhigend? – zwischen den Stämmen eines Palmenhains; hitziges
Orange und Pink lodern hinter dem Pflanzenwuchs am Rand des Seerosenteichs,
um im nächsten Werk zum Altrosa eines erschöpften Gewitterhimmels zu
verblassen.
Wer
sich auf die Reise durch Theins Bildwelten begibt, tut gut daran, auf alles
gefasst zu sein: Was beim ersten Hinschauen als liebliches Parkidyll oder
reiseprospekttaugliche Südseefantasie erscheint, ist malerisch und motivisch deutlich
komplexer und subtiler. In Gestalt von dunkel wuchernden Zimmerpflanzen
bricht sich das Irrationale, Wilde im geordneten Bezirk einer menschlichen
Behausung Bahn. Der Blick verstrickt sich im Dickicht der Wälder und
Treibhäuser. Formen erscheinen und lösen sich wieder auf, ehe wir sie
fixieren und einordnen können. Die Betrachtung gerät zum permanenten Vor und
Zurück zwischen der Oberfläche des Bildes und seinen tieferen Schichten, zum
Hin und Her zwischen abstrakten Farbstrukturen und den erkennbaren Elementen
einer scheinbar ungezügelten Vegetation.
 Lukas
Thein entwirft keine romantisch überhöhten Sehnsuchtslandschaften, die einen
– wie auch immer gearteten – Einklang von Mensch und Natur beschwören. Zwar
ist der Mensch präsent in den paradiesisch anmutenden Naturräumen, jedoch
bleibt er darin ein Fremder, von dessen Anwesenheit oft lediglich Spuren
zivilisatorischer Interventionen zeugen – außerordentlich fragile
Architekturen in Form von Glashäusern und Pavillons oder kleine Labels, die
im botanischen Garten der Identifizierung exotischer Pflanzen dienen, bei
Thein aber keine lesbare Botschaft präsentieren und als cartes blanches für
die Betrachter*in wirken, die eingeladen ist, die Leerstellen kraft ihrer
eigenen Imagination zu füllen. Lukas
Thein entwirft keine romantisch überhöhten Sehnsuchtslandschaften, die einen
– wie auch immer gearteten – Einklang von Mensch und Natur beschwören. Zwar
ist der Mensch präsent in den paradiesisch anmutenden Naturräumen, jedoch
bleibt er darin ein Fremder, von dessen Anwesenheit oft lediglich Spuren
zivilisatorischer Interventionen zeugen – außerordentlich fragile
Architekturen in Form von Glashäusern und Pavillons oder kleine Labels, die
im botanischen Garten der Identifizierung exotischer Pflanzen dienen, bei
Thein aber keine lesbare Botschaft präsentieren und als cartes blanches für
die Betrachter*in wirken, die eingeladen ist, die Leerstellen kraft ihrer
eigenen Imagination zu füllen.
In
diesem Sinne geben auch die gelegentlich auftauchenden Figuren ihre Identität
nicht preis – es ist möglich, aber keineswegs zwingend, in ihnen ein Alter
Ego des Künstlers zu erkennen: Häufig bleibt ihr Gesicht außerhalb des
gewählten Bildausschnitts oder sie sind in Rückenansicht dargestellt wie der
junge Mann im roten Hemd, von dem wir uns gerade aus diesem Grund gerne ins
Bild hineinleiten lassen. Sein leicht geneigter Kopf und dergestalt
demonstrativ NICHT auf die sich vor ihm ausbreitende Landschaft gerichteter
Blick regen zur kontemplativen Versenkung in den Farbraum des Gemäldes, einem
innerlichen Sehen an.
 Auf
seinen malerischen Streifzügen gerät Lukas Thein immer wieder in
Grenzbereiche der Figuration, in denen die motivische Fixierung zugunsten der
reinen Farbwirkung nahezu vollständig aufgegeben ist. Gleichwohl ist seine
Kunst (fast) jederzeit getragen vom leidenschaftlichen Interesse an ihrem
Sujet: Die Welt der Pflanzen in ihrer faszinierenden Vielfalt stellt
gattungsübergreifend DAS zentrale Thema bereit, dem Thein sich nicht nur im
Medium der Malerei, sondern auch in Installationen und Druckgrafiken mit
bemerkenswerter Ausschließlichkeit widmet. Auf
seinen malerischen Streifzügen gerät Lukas Thein immer wieder in
Grenzbereiche der Figuration, in denen die motivische Fixierung zugunsten der
reinen Farbwirkung nahezu vollständig aufgegeben ist. Gleichwohl ist seine
Kunst (fast) jederzeit getragen vom leidenschaftlichen Interesse an ihrem
Sujet: Die Welt der Pflanzen in ihrer faszinierenden Vielfalt stellt
gattungsübergreifend DAS zentrale Thema bereit, dem Thein sich nicht nur im
Medium der Malerei, sondern auch in Installationen und Druckgrafiken mit
bemerkenswerter Ausschließlichkeit widmet.
Bisweilen
spricht aus den Arbeiten eine geradezu wissenschaftliche Neugier, am
deutlichsten vielleicht im Fall der Cyanotypien zur „Alpenflora des Alexander
Berthold“: Die zartblauen Pflanzenstudien sind Abzüge von Einzelbögen eines
über 100 Jahre alten Herbariums, die Thein mithilfe eines alten
fotografischen Verfahrens genommen hat. Somit sind sie Ausdruck nicht nur der
künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Motiv an sich, sondern auch mit
einem naturwissenschaftlichen Ordnungssystem und – nebenbei – einem weitgehend
in Vergessenheit geratenen Bildgebungsverfahren, das im 19. Jahrhundert vor
allem zur fotografischen Dokumentation botanischer Proben eingesetzt
wurde.
 Wie
die Malerei sind auch die Cyanotypien gewissermaßen Teil des größer
angelegten Versuchs einer Weltbeschreibung – von Alexander Berthold zu
Alexander von Humboldt ist es nicht nur phonetisch lediglich ein kleiner
Schritt. Weil Lukas Thein aber in erster Linie Künstler ist, geht es seiner
Weltgartenschau dabei nicht um den empirischen Erkenntnisgewinn, sondern um
eine über die objektive Außenseite hinausweisende Betrachtung: Die Blumen und
Gräser der Alpenflora-Mappe dürfen in der künstlerischen Bearbeitung unscharf
erscheinen, die natürliche Ordnung von Landschaften, Gärten und Wäldern wird
durch die nicht unbedingt an realer Seherfahrung orientierte Farbgebung
ausgehebelt. Wie
die Malerei sind auch die Cyanotypien gewissermaßen Teil des größer
angelegten Versuchs einer Weltbeschreibung – von Alexander Berthold zu
Alexander von Humboldt ist es nicht nur phonetisch lediglich ein kleiner
Schritt. Weil Lukas Thein aber in erster Linie Künstler ist, geht es seiner
Weltgartenschau dabei nicht um den empirischen Erkenntnisgewinn, sondern um
eine über die objektive Außenseite hinausweisende Betrachtung: Die Blumen und
Gräser der Alpenflora-Mappe dürfen in der künstlerischen Bearbeitung unscharf
erscheinen, die natürliche Ordnung von Landschaften, Gärten und Wäldern wird
durch die nicht unbedingt an realer Seherfahrung orientierte Farbgebung
ausgehebelt.
Dergestalt
halten Lukas Theins in jeder Hinsicht vielschichtige Bildwelten eine Fülle
aufregender, mitunter irritierender ästhetischer Erfahrungen bereit. Auf dem
Weg durch vertrautes, aber gleichwohl unbekanntes Terrain öffnen sich unserer
Vorstellungskraft dabei immer wieder Schlupflöcher, Korridore und magische
Pforten – auf der anderen Seite mag jede Betrachter*in ihre eigenen Antworten
finden.

Sehr verehrtes Kunstpublikum,
zur Einstimmung auf die Landesgartenschau im Mai 2021 in
Lindau, zeigt Lukas Thein eine Reihe seiner in Eitempera gemalten
Landschaften und Gärten der Welt. Aus seinen unwirklichen Darstellungen
exotisch-tropischer Botanik genau so wie aus Schwarzwaldbeständen scheint das
verschollene Eden zu leuchten.
Während der Vernissage verführt Lukas Briggen mit seinem
rufenden Alphornspiel uns Erdenbürger mit Negativbilanz zu unbeschwert
lauschenden Augenblicken.
HERZLICH WILLKOMMEN!
Pressetext:
Wie kann ich innerhalb eines Bildes und mittels desselben
Wahrheit erzeugen?
Wieviel "Möglichkeitssinn" muss ich entwickeln, um
innerhalb der Auswahl einer Farbpalette malerisch eine "Echtheit"
auch dann noch erhalten zu können, wenn die Wahl der verwendeten Farben sich
längst nicht mehr am Wirklichkeitsgefüge exakter Wiedergabe orientiert.
Treffender als wieder-erkennbare Genauigkeit im Objekt ist Gewissenhaftigkeit
im seelischen Ausdruck. Hervorgerufen wird ein solcher Ausdruck durch die
Farbe. In gekonnt kühner Farbauswahl setzt Lukas Thein dem Betrachter seine
Rätselwelt vor, ein wenig distanziert, keineswegs unterkühlt - gebremstes
Appassionato.
(Arturo Eskuchen. 2014)
←
|